Premiere: 21. Februar 2026, Schauspielhaus
Eine Schneise der Zerstörung zieht sich durch Moskau. Menschen werden verschleppt, gefoltert, hingerichtet, unsichtbar gemacht. Doch daneben geht all das weiter seinen Gang, was man gemeinhin das »normale Leben« nennt: Die Trams fahren, die Läden sind geöffnet, man geht ins Theater, macht Geschäfte, spinnt Intrigen. Im Zentrum des Geschehens steht ein unheimlicher Fremder – ein Deutscher? Pole? Engländer? – dem eine Entourage skurriler Gestalten folgt. Wer ist Woland wirklich, der sich »Professor für schwarze Magie« oder einfach nur bescheiden »Berater« nennt? Ist das Böse, das von ihm auszugehen scheint, wirklich sein eigenes Werk? Oder verleiht er nur der diffusen Gewalt, die er überall vorfindet, eine jeweils überraschend neue, scharfe und brutale Form? Repression, die sich zur neuen Normalität erklärt, verbreitet nicht nur Schrecken, sondern auch eine unfreiwillige, makabre Komik: Die neue Welt ist eine Farce, wenngleich eine blutige.
Der russische Exilregisseur Timofej Kuljabin zeichnet in seiner Adaption von Bulgakows Weltroman das Bild einer korrupten Gesellschaft, in der die Unberechenbarkeit allgegenwärtiger Gewalt zum System geworden ist. Aus der Perspektive einer forensischen Rekonstruktion legt er die Mechanismen heutiger totalitärer Herrschaft frei.
Regie Timofej Kuljabin Bühne Oleg Golovko Kostüme Vlada Pomirkovannaya Musik Timofey Pastukhov Dramaturgie Olga Fedyanina, Alexander Leiffheidt
zur Schauspiel Frankfurt Webseite

















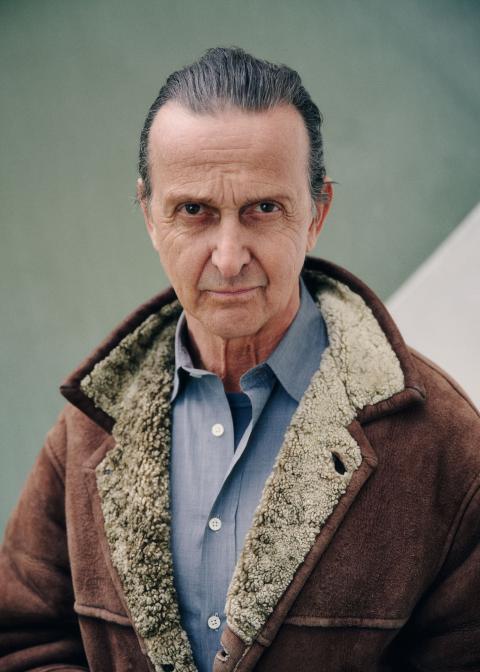 Matthias
Matthias Isaak
Isaak Anabel
Anabel Arash
Arash Katharina
Katharina Melanie
Melanie Anna
Anna André
André Sarah
Sarah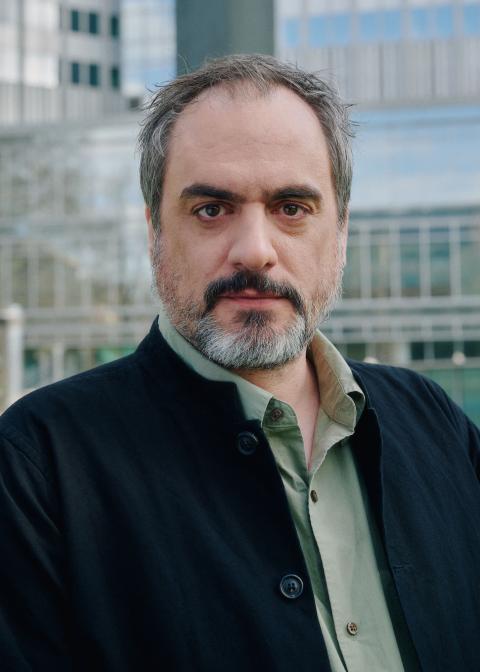 Sebastian
Sebastian Lotte
Lotte Wolfram
Wolfram