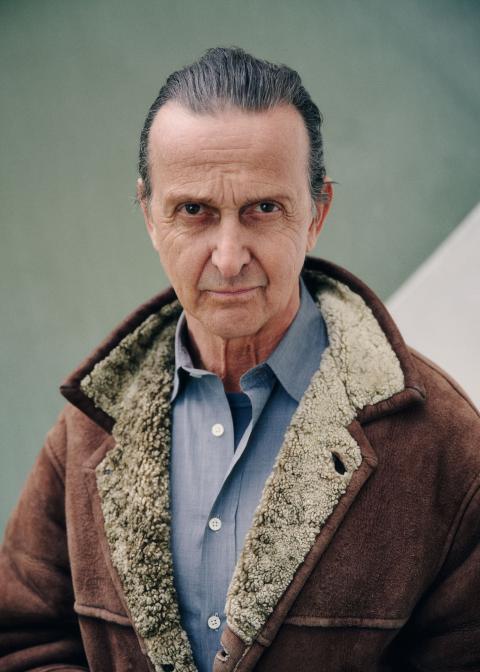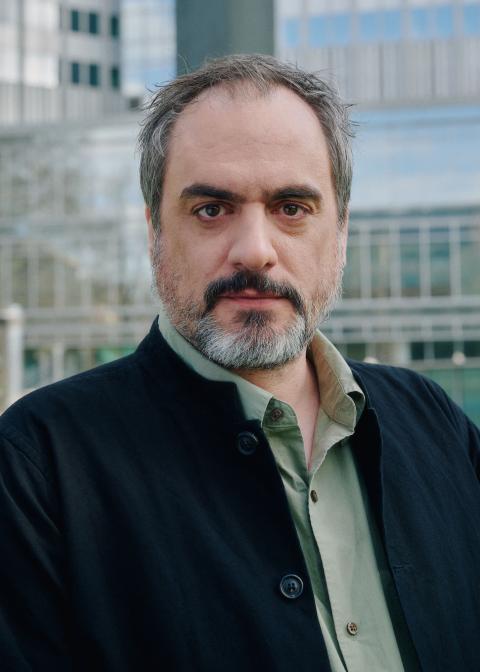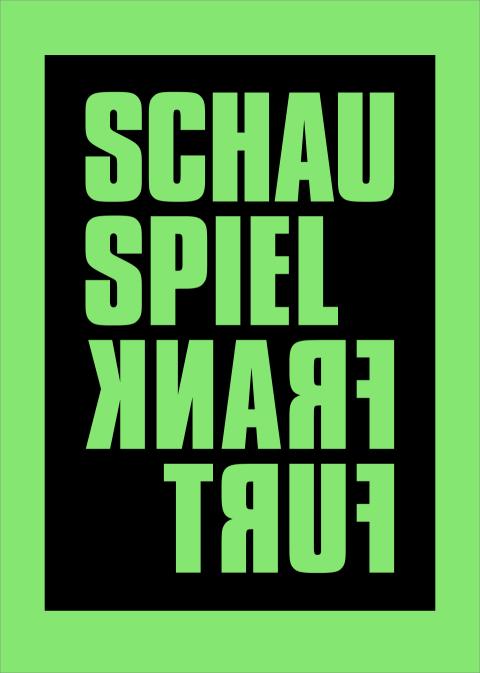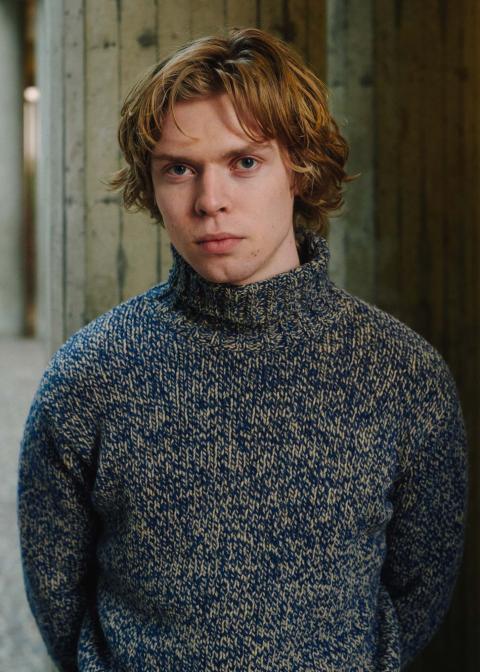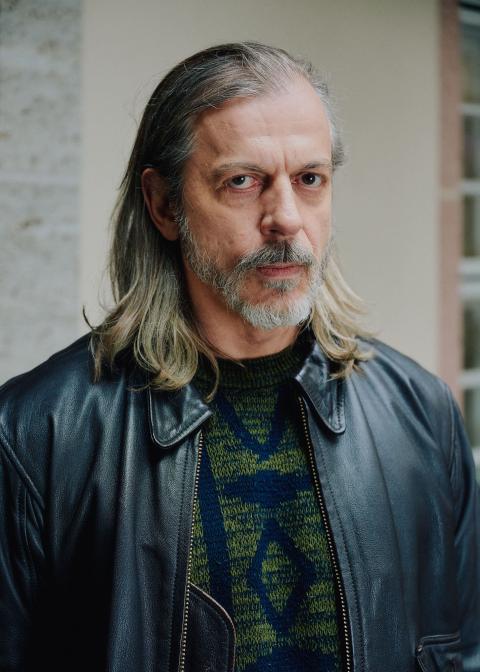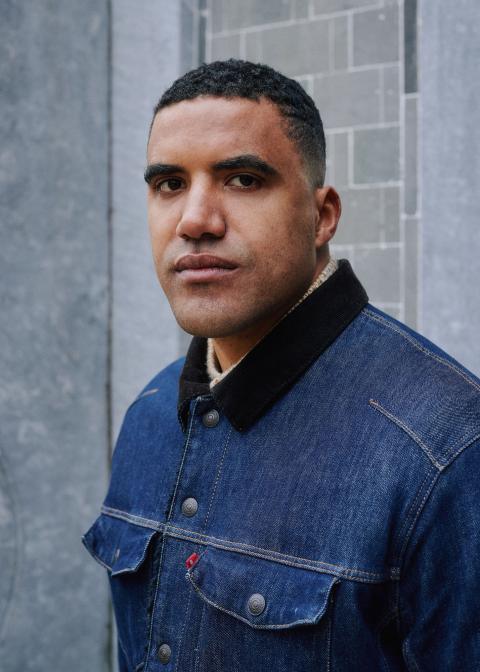Über die Möglichkeit des Widerstands.
Alexander Leiffheidt über »Antigone«
Antigone ist die Tragödie der Widersprüche, der anscheinend unauflösbaren, schicksalshaften Gegensätzlichkeit. Wie kaum ein anderes antikes Drama entzweit ihre Geschichte die Meinungen der Lesenden und Schauenden, beunruhigt die Gemüter und weist auf Fragen, die immer wieder neue Antworten herausfordern. Worauf beruht Antigones unbedingter Wille, das Gesetz Kreons zu brechen und den Bruder zu bestatten? Ihre Erklärungen im Dialog mit Ismene und später Kreon münden in einige der rätselhaftesten Sätze des ganzen Textes. Was gewinnt Antigone durch die öffentliche Demütigung ihrer Schwester vor Kreon? Woher nimmt Ismene den jähen Mut zur Solidarität? Warum wittert Kreon rings um sich her Korruption und Verrat? Er hat kaum äußeren Anlass dazu. Wenn Teiresias ihm eben diese Frage stellt, weicht er der Antwort aus. Was verursacht Kreons Sinneswandel am Ende des Stückes, wo er doch zuvor vier Auftritte lang unbeirrbar am Todesurteil über Antigone festgehalten hat?
Der Katalog solcher Fragen ließe sich beinahe beliebig lange fortsetzen. Im Zentrum steht dabei die eine Frage, die alle anderen überragt: Was ist das Maß rechten Handelns – sittliches, gar göttlich gegebenes Gewissen, oder die politisch orientierte Ordnung staatlicher Gesetze? Wer hat Recht? Antigone oder Kreon? Und was bedeutet es, wenn niemand Recht haben sollte?
Als seine »Antigone« ca. 441 v. Chr. uraufgeführt wird, ist Sophokles bereits Mitte fünfzig. Er stammt aus einer wohlhabenden Athener Familie, bekleidet im Laufe seines Lebens einige Ämter, ist aber vor allem erfolgreich als Verfasser von Dramen. 470 v. Chr. nimmt er zum ersten Mal an dem Dramenwettbewerb teil, den die Athener jedes Jahr im Rahmen der Großen Dionysien, der Festspiele zu Ehren des Gottes Dionysos, im März und April veranstalten. Aus den erhaltenen Dokumenten geht hervor, dass er sich insgesamt dreißig Mal dem Urteil der Preisrichter und des Publikums stellt, und zwar jeweils – wie es die Regeln vorsehen – mit einer Tetralogie von Tragödien und einem Satyrspiel. Etwa zwei Drittel dieser Wettbewerbe gewinnt er, bei den restlichen zehn oder zwölf Anlässen wird er Zweiter. Dritter wird er nie. Es muss also mindestens 120 Dramen von Sophokles gegeben haben, und vermutlich keine schlechten. Erhalten sind nur sieben. »Antigone« ist eins von ihnen; die anderen beiden Sophokles-Tragödien dieses Jahres sowie das begleitende Satyrspiel sind verschollen.
Der Katalog solcher Fragen ließe sich beinahe beliebig lange fortsetzen. Im Zentrum steht dabei die eine Frage, die alle anderen überragt: Was ist das Maß rechten Handelns – sittliches, gar göttlich gegebenes Gewissen, oder die politisch orientierte Ordnung staatlicher Gesetze? Wer hat Recht? Antigone oder Kreon? Und was bedeutet es, wenn niemand Recht haben sollte?
Als seine »Antigone« ca. 441 v. Chr. uraufgeführt wird, ist Sophokles bereits Mitte fünfzig. Er stammt aus einer wohlhabenden Athener Familie, bekleidet im Laufe seines Lebens einige Ämter, ist aber vor allem erfolgreich als Verfasser von Dramen. 470 v. Chr. nimmt er zum ersten Mal an dem Dramenwettbewerb teil, den die Athener jedes Jahr im Rahmen der Großen Dionysien, der Festspiele zu Ehren des Gottes Dionysos, im März und April veranstalten. Aus den erhaltenen Dokumenten geht hervor, dass er sich insgesamt dreißig Mal dem Urteil der Preisrichter und des Publikums stellt, und zwar jeweils – wie es die Regeln vorsehen – mit einer Tetralogie von Tragödien und einem Satyrspiel. Etwa zwei Drittel dieser Wettbewerbe gewinnt er, bei den restlichen zehn oder zwölf Anlässen wird er Zweiter. Dritter wird er nie. Es muss also mindestens 120 Dramen von Sophokles gegeben haben, und vermutlich keine schlechten. Erhalten sind nur sieben. »Antigone« ist eins von ihnen; die anderen beiden Sophokles-Tragödien dieses Jahres sowie das begleitende Satyrspiel sind verschollen.
Mit gegenwärtigen Theateraufführungen hatten die Dionysien des Jahres 441 v. Chr. kaum etwas zu tun.
Den Graben, der uns Heutige von diesen jahrtausendealten Texten trennt, können wir uns kaum tief genug vorstellen. Mit gegenwärtigen Theateraufführungen hatten die Dionysien des Jahres 441 v. Chr. kaum etwas zu tun. Die Vorstellungen waren Kulthandlungen, also (um einen späteren, aber uns näheren Begriff zu verwenden) Gottesdienste. Die Aufführungen begannen am frühen Morgen, die Zuschauer (Männer aus Athen und dem Umland, in den oberen Reihen auch Frauen) saßen im Freien auf einer riesigen, 15.000 bis 17.000 Menschen fassenden dreiseitigen Tribüne am Südhang der Akropolis (zur Orientierung: Athen hatte zu dieser Zeit ca. 25.000 Einwohner). Die Schauspieler – allesamt Männer, und zu Sophokles’ Zeiten bereits staatlich bezahlte Profis – spielten mehrere Rollen, die sich durch Kostüm und Maske deutlich voneinander unterscheiden ließen. Bis ins 5. Jh. v. Chr. waren es nur zwei Spieler; eine der Innovationen Sophokles’ war die Hinzufügung eines dritten. Die Stoffe der Stücke entstammten im Allgemeinen dem Mythos und der Tradition Homers. Sie waren allen Beteiligten vertraut und geläufig, wenngleich sie bereits damals als in weiter Ferne liegend empfunden wurden. Die Unterscheidung zwischen künstlerischer Fiktion und Wahrheit war in dieser Form noch unbekannt. Figurenpsychologie, Entwicklung, Realismus, authentisches Erleben – nichts von alledem spielte bei den Aufführungen eine Rolle, die sich mit unserem heutigen Theaterverständnis vergleichen ließe.
Dass wir Nachgeborenen die »Antigone« also nicht verstehen, ist im Grunde nicht erstaunlich.
Dass wir Nachgeborenen die »Antigone« also nicht verstehen, ist im Grunde nicht erstaunlich. Erstaunlich ist vielmehr, wie viel wir eben doch verstehen – und immer wieder aufs Neue verstehen. Der Text des Dramas wird seit beinahe zweieinhalbtausend Jahren gelesen. Er war niemals ganz verloren. Nach der einmaligen »Uraufführung« (erst ab 386 v. Chr. durften die Stücke des Dramenwettbewerbs wiederholt werden) wurde Sophokles’ Manuskript von Gelehrten in der Bibliothek von Alexandria abgeschrieben und archiviert. Byzantinische Kollegen setzen diese Tradition durch das Mittelalter hindurch fort; die ältesten erhaltenen Abschriften stammen aus dem 10. Jahrhundert. Mit dem Fall Konstantinopels 1453 kamen die Werke nach Europa. Hier wurde »Antigone« in Italien 1502 zum ersten Mal gedruckt. Julius Caesar Scaliger, Martin Opitz, Jean de La Fontaine, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Gottfried Herder und Friedrich Schiller (um nur einige zu nennen) beschäftigten sich unmittelbar und zum Teil ausführlich mit dem Werk.
Im 19. Jahrhundert weckt »Antigone« dann das Interesse der Philosophen. Sie wird zum Modellfall eines Normenkonflikts, einer schicksalhaften Verletzung von Ordnungen des Handelns und Denkens, zur »Figur der Überschreitung« (Johanna Bossinade). Friedrich Hegel entwickelt anhand seiner Antigone-Interpretation in der »Phänomenologie des Geistes« eine Theorie des ethischen Handelns, das immer im Konflikt zwischen unterschiedlichen sittlichen Substanzen stehe. Søren Kierkegaard widmet sich – mit weitreichenden Folgen für die weitere Rezeptionsgeschichte – als einer der ersten dem Innenleben der Figur und analysiert, wie aus dem Konflikt Antigones zugleich Identität und Tod entstehen. Jacques Lacan versteht Antigone als Verkörperung eines »reinen Begehrens«, das sich selbst auch um den Preis der eigenen Zerstörung ausgeliefert bleibe, und leitet aus dieser Interpretation ethische Prinzipien ab. Daneben fasziniert ihn vor allem die Position Antigones »zwischen zwei Toden«, nämlich dem biologischen Tod, der sie am Ende ereilt, und dem symbolischen Tod, der aus ihrer Übertretung herrührt.
Auffällig aus der Perspektive des Theaters, das sich ja letztlich immer zuerst für das Drama und seine Realisation interessieren muss, ist eine gewisse Einseitigkeit dieser Beziehungen. Nach ausgiebiger Lektüre der entsprechenden Texte hat man zwar mit etwas Glück mehr über Hegel oder Lacan, aber kaum etwas Neues über »Antigone« erfahren. Im Gegensatz zu ihrem Vater Ödipus, den Sigmund Freud zum universalen Modell des denkenden, irrenden und begehrenden Menschen erhebt, bleibt Antigone in ihrer Rezeption außerdem auch zumeist eine Einzelfigur, die nur für sich allein steht. Wie könnte es anders sein – sie ist eine Frau, über die in erster Linie Männer schreiben. Das ändert sich erst ab den 1970er- und 1980er-Jahren Jahren. Mit Judith Butler, Luce Irigaray und Julia Kristeva nehmen sich auch führende Vertreterinnen einer feministisch geprägten Theoriebildung des Textes an.
Im 19. Jahrhundert weckt »Antigone« dann das Interesse der Philosophen. Sie wird zum Modellfall eines Normenkonflikts, einer schicksalhaften Verletzung von Ordnungen des Handelns und Denkens, zur »Figur der Überschreitung« (Johanna Bossinade). Friedrich Hegel entwickelt anhand seiner Antigone-Interpretation in der »Phänomenologie des Geistes« eine Theorie des ethischen Handelns, das immer im Konflikt zwischen unterschiedlichen sittlichen Substanzen stehe. Søren Kierkegaard widmet sich – mit weitreichenden Folgen für die weitere Rezeptionsgeschichte – als einer der ersten dem Innenleben der Figur und analysiert, wie aus dem Konflikt Antigones zugleich Identität und Tod entstehen. Jacques Lacan versteht Antigone als Verkörperung eines »reinen Begehrens«, das sich selbst auch um den Preis der eigenen Zerstörung ausgeliefert bleibe, und leitet aus dieser Interpretation ethische Prinzipien ab. Daneben fasziniert ihn vor allem die Position Antigones »zwischen zwei Toden«, nämlich dem biologischen Tod, der sie am Ende ereilt, und dem symbolischen Tod, der aus ihrer Übertretung herrührt.
Auffällig aus der Perspektive des Theaters, das sich ja letztlich immer zuerst für das Drama und seine Realisation interessieren muss, ist eine gewisse Einseitigkeit dieser Beziehungen. Nach ausgiebiger Lektüre der entsprechenden Texte hat man zwar mit etwas Glück mehr über Hegel oder Lacan, aber kaum etwas Neues über »Antigone« erfahren. Im Gegensatz zu ihrem Vater Ödipus, den Sigmund Freud zum universalen Modell des denkenden, irrenden und begehrenden Menschen erhebt, bleibt Antigone in ihrer Rezeption außerdem auch zumeist eine Einzelfigur, die nur für sich allein steht. Wie könnte es anders sein – sie ist eine Frau, über die in erster Linie Männer schreiben. Das ändert sich erst ab den 1970er- und 1980er-Jahren Jahren. Mit Judith Butler, Luce Irigaray und Julia Kristeva nehmen sich auch führende Vertreterinnen einer feministisch geprägten Theoriebildung des Textes an.
Wie müsste eine Welt aussehen, in der Antigone am Leben geblieben wäre?
Wie müsste eine Welt aussehen, in der Antigone am Leben geblieben wäre? So lautet in etwa die Überschrift eines Gesprächs, das Judith Butler 2001 mit dem Frankfurter Philosophen Martin Saar und der Berliner Publizistin Carolin Emcke führte. Eine interessante Akzentverschiebung, die programmatisch für Butlers Beschäftigung mit »Antigone« im Allgemeinen steht. Butler führt den Blick über die Antinomie des zentralen Konflikts zwischen Antigone und Kreon hinaus ins Politische, lenkt ihn mithin auf die Bedingungen der Handlungsräume und ihrer Begrenzungen, in denen sich die zentralen Figuren bewegen, und untersucht dabei den Text des Dramas mit größter Genauigkeit. In gewisser Weise, so ihr Fazit, hat tatsächlich niemand »Recht« in dieser Tragödie. Antigone erscheint hier als eine Figur, die durch ihre Handlung ein System unterläuft, dessen Teil sie dabei doch unweigerlich bleiben muss. Sie steht sowohl außerhalb als auch innerhalb der normativen Ordnungen, destabilisiert Begriffe von Familie, Verwandtschaft, Bürgerschaft und Geschlecht und kann doch nicht anders, als sie zugleich in sich (und durch ihr Handeln) zu realisieren.
Damit liest Butler »Antigone« im Kontext der Konstitution dessen, was die Soziologin Helen Fein das »Universum der Bindungen« (Universe of Obligation) genannt hat: also den »Kreis derjenigen Individuen und Gruppen, denen gegenüber grundsätzlich Verpflichtungen bestehen können, für die Regeln (z. B. der Bestattung, AL) gelten und deren Benachteiligung oder Verletzung gesühnt werden muss« (Fein). Wer zum »Universe of Obligation« gehört, ist also Subjekt – alle außerhalb sind entmenschlicht, sind damit Verfolgung, Diskriminierung und Gewalt bis zur Zerstörung hilflos ausgesetzt. Die Verhandlung der Grenzen des Universums der Bindungen ist damit ein hochgradig politischer Konflikt mit weitreichenden Folgen, der aktuell wieder überall auf der Welt, auch in den europäischen Gesellschaften, mit großer Schärfe und teils verheerenden Auswirkungen auf die Betroffenen geführt wird. Es ist eine Frage, die zu Sophokles’ Zeiten ebenso virulent war wie heute und die uns daher dabei helfen kann, den tiefen Graben der Fremdheit, der uns von diesem Text trennt, zu überwinden.
Damit liest Butler »Antigone« im Kontext der Konstitution dessen, was die Soziologin Helen Fein das »Universum der Bindungen« (Universe of Obligation) genannt hat: also den »Kreis derjenigen Individuen und Gruppen, denen gegenüber grundsätzlich Verpflichtungen bestehen können, für die Regeln (z. B. der Bestattung, AL) gelten und deren Benachteiligung oder Verletzung gesühnt werden muss« (Fein). Wer zum »Universe of Obligation« gehört, ist also Subjekt – alle außerhalb sind entmenschlicht, sind damit Verfolgung, Diskriminierung und Gewalt bis zur Zerstörung hilflos ausgesetzt. Die Verhandlung der Grenzen des Universums der Bindungen ist damit ein hochgradig politischer Konflikt mit weitreichenden Folgen, der aktuell wieder überall auf der Welt, auch in den europäischen Gesellschaften, mit großer Schärfe und teils verheerenden Auswirkungen auf die Betroffenen geführt wird. Es ist eine Frage, die zu Sophokles’ Zeiten ebenso virulent war wie heute und die uns daher dabei helfen kann, den tiefen Graben der Fremdheit, der uns von diesem Text trennt, zu überwinden.
Selen Karas Frankfurter Inszenierung ist von Respekt vor dieser Fremdheit geprägt, ohne dabei in Ehrfurcht vor dem Text zu verharren.
Selen Karas Frankfurter Inszenierung ist von Respekt vor dieser Fremdheit geprägt, ohne dabei in Ehrfurcht vor dem Text zu verharren. Sie verzichtet auf oberflächliche visuelle Aktualisierung und setzt ihre Antigone stattdessen in eine streng strukturierte Kunstwelt, die einerseits in monumentalen Bildern erzählen, andererseits auch die Darsteller und Darstellerinnen in einer beinahe intimen, kammerspielartigen Nähe zum Publikum agieren lassen kann. Damit ist der Pfad angelegt, auf den Kara uns durch das rätselhafte Dickicht dieses Textes führt: Sie betont die politische Dimension des Stoffes, ergänzt sie aber durch die Nahaufnahme der Seelenlandschaft vor allem ihrer Protagonistin. An zwei zentralen Positionen der dramaturgischen Struktur erweitert ein moderner Text der Autorin Anna Gschnitzer das antike Drama. Wir erleben Antigone im Gespräch mit ihrer toten Mutter Iokaste, die bei Sophokles nicht auftritt, und mit dem »Staub«, der in dieser Tragödie eine so zentrale Rolle spielt: als Staub, zu dem die Toten werden und der die Toten bedeckt, als omnipräsentes Schicksal, als Fluch und Metapher für die Verstrickung Antigones in die fatalen Ordnungen und Unordnungen ihrer Existenz. Es ist die Stimme ihrer Mutter, die Antigone im größten Moment des Zweifels am Wert ihrer Tat eine zaghaft utopische Perspektive eröffnet: »Der Widerstand beginnt. Er beginnt, indem du ihre Härte nicht mehr gegen dich richtest. Die Gewalt nicht weiter trägst, so wie ich es getan habe.«
Diesen und andere begleitende Texte zur Inszenierung finden Sie im Programmheft, das zu den Vorstellungen und auch an der Vorverkaufskasse sowie im Webshop erhältlich ist.