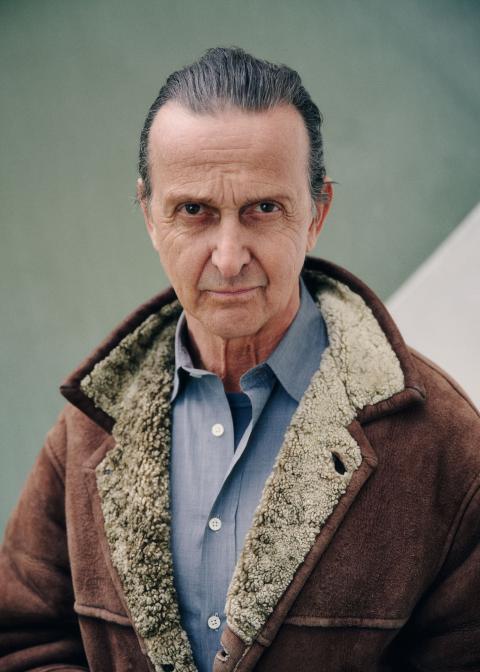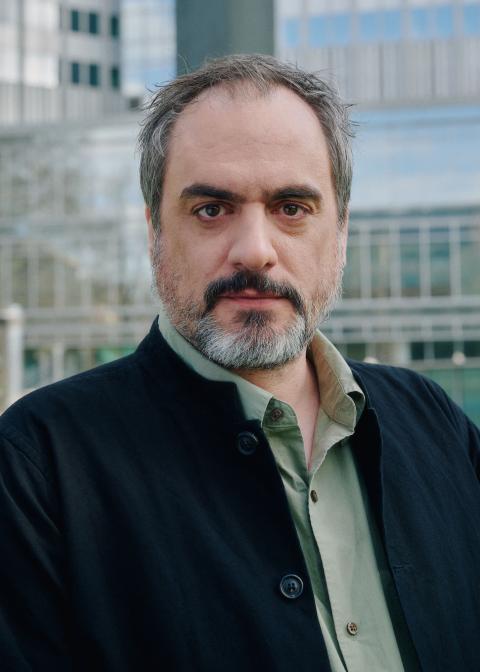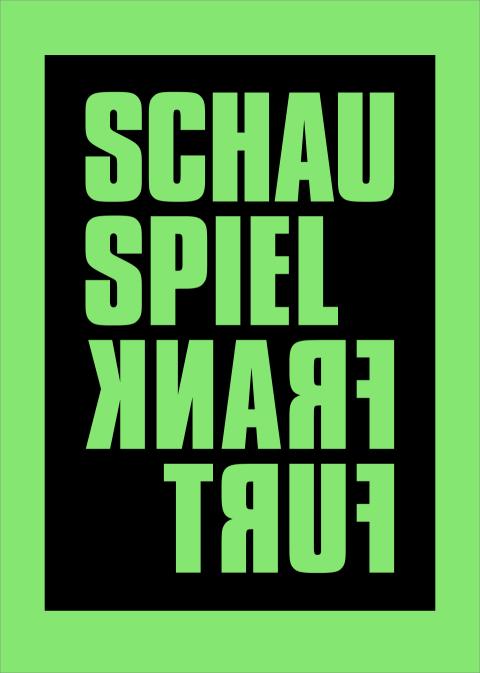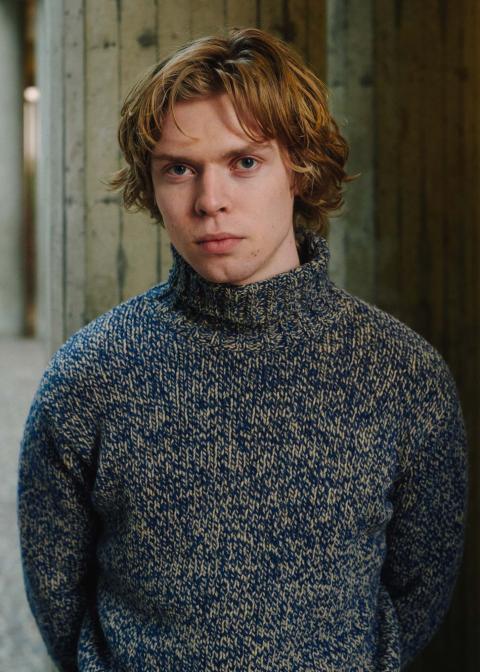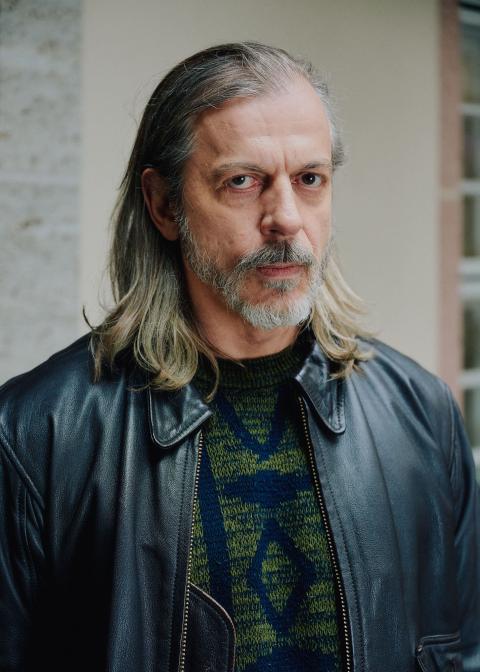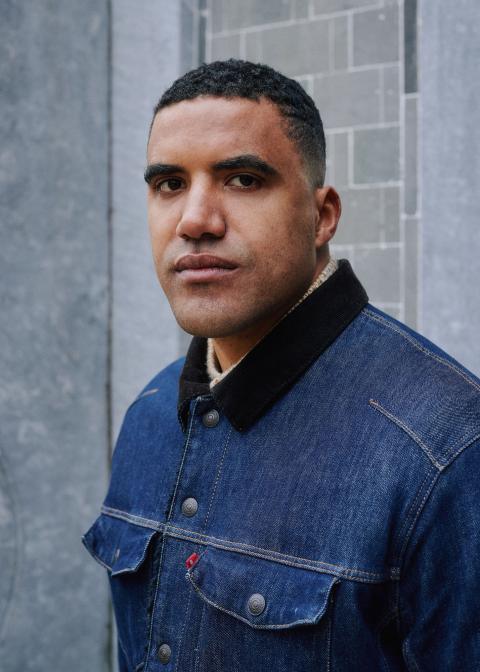»Es ist das Gangsterstück, das jeder kennt«
Katja Herlemann »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui«
Frühling 1941: Die Nationalsozialisten befinden sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht, haben einen Großteil West- und Nordeuropas, darunter Teile Polens und Frankreichs, besetzt und richten ihre Aggression Richtung Südosteuropa. Bertolt Brecht befindet sich mit seiner Familie im finnischen Exil und bereitet seine Ausreise in die USA vor. Als er in nur wenigen Wochen in großer Eile das Stück »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui« schreibt, hat er also bereits das potenzielle amerikanische Publikum im Blick. Um »der kapitalistischen Welt den Aufstieg Hitlers zu erklären«, versetzt ihn Brecht nach eigener Aussage »in ein ihr vertrautes Milieu.« Für das US-amerikanische Gangstermilieu, in das er die Handlung seines Stückes verlegt, hat er sich bereits bei früheren USA-Besuchen lebhaft interessiert, gerade für die Art und Weise, wie die Erfolgsbiographien von Mafiabossen den Erzählungen des amerikanischen Mythos vom ›self-made man‹ aus der legalen Sphäre der Geschäftstüchtigkeit ähneln.
Für seine »Historienfarce« macht Brecht eine Engführung bestimmter Schlüsselereignisse der Karriere Adolf Hitlers mit der Aufstiegsgeschichte eines Gangsters, die eine gewisse Ähnlichkeit zu der Biografie Al Capones aufweist. Die deutschen Kapitaleigner der 1930-er Jahre (Junker und Industrielle) übersetzt er in Mitglieder eines von Absatzschwierigkeiten bedrängten Karfiol-Trusts in Chicago (Karfiol = Blumenkohl). Die wertegeleitete Stadtpolitik erweist sich als wenig wehrhaft gegen die halblegalen Machenschaften der Großunternehmer. Arturo Ui, ein kleiner Gangster, der sich zu Höherem berufen fühlt, wird zunächst noch aus den korrupten Geschäften herausgehalten, weiß aber die Schwächen der anderen geschickt gegeneinander auszuspielen. Scheinbar unaufhaltsam installiert er mit seiner Gangsterbande ein Regime des Terrors in der Stadt, gegen das aus Mitschuld und aus Angst niemand mehr aufzubegehren wagt. Die öffentliche Meinung wird frech manipuliert, die wenigen Stimmen der Wahrheit werden gewaltsam zum Schweigen gebracht.
Eine »Doppelverfremdung« erreicht Brecht in seinem Text durch die Entscheidung, seine Gangster und Händler in Jamben sprechen zu lassen, denn »die Verssprache macht das Heldentum der Figuren messbar«. Punktuelle Referenzen zu großen klassischen Stoffen von Shakespeare bis Goethe zeigen eine Möglichkeit, in ihrer idealistischen Übersteigerung Vorbild für den Faschismus zu sein. Der »hohe Stil« ist daher keine Parodie, sondern eine Entlarvung der moralischen Anstalt als höchst korrumpierbar.
Brechts Zeitgenossen konnten natürlich jeden Baustein und jede Figur der Parabel, die er auf »die Ebene von Staat, Industriellen, Junkern und Kleinbürgern« beschränkt, leicht auf ihr reales Pendant und Ereignis zurückführen. Schrifttafeln mit konkreten Hinweisen, welche die Aufführung unterbrechen sollten, hätten das weiter befördert. Trotzdem war es Brecht ein besonderes Anliegen, die eine Ebene nicht zugunsten der anderen zu betonen, sondern ein eigenständiges Narrativ zu entwickeln, das auch ohne zeitgeschichtliche Referenzen einer schlüssigen Dramaturgie folgt. Am 1. April 1941 schreibt er dazu in sein Arbeitsjournal:
»Im ui kam es darauf an, einerseits immerfort die historischen vorgänge durchscheinen zu lassen, andererseits die ‘verhüllung’ (die eine enthüllung ist) mit eigenleben auszustatten, dh, sie muß - theoretisch genommen - auch ohne ihre anzüglichkeit wirken. unter anderem wäre eine zu enge verknüpfung der beiden handlungen (gangster- und nazihandlung), also eine form, bei der die gangsterhandlung nur eine symbolisierung der andern handlung wäre, schon dadurch unerträglich, weil man dann unaufhörlich nach der ‘bedeutung’ dieses oder jenes zuges suchen würde, bei jeder figur nach dem urbild forschen würde, das war besonders schwer.«
Für ein deutsches Publikum stellt die Verlegung der Nazihandlung nach Chicago einen Verfremdungseffekt dar - für das Publikum in den USA vollzog sich damals damit wohl eher eine befremdliche Aneignung. Hitler diente in den USA als politischer Fetisch in Gestalt einer Verkörperung maximal unamerikanischen Ungeistes. Dass Brecht den Nazismus entnationalisierte und durch die Auswahl bzw. Reduktion der Kausalitäten, die zur Machtergreifung Hitlers führten, ursächlich auf die Logik des Kapitalismus konzentrierte, traf in den USA nicht den herrschenden Geschmack.
Obwohl 1941 geschrieben und von Brecht »als aufführung von 1941 gesehen", kam das Stück schließlich erst 1958, nach Bertolt Brechts Tod zwei Jahre zuvor, in Deutschland auf die Bühne, in den USA noch später. In der posthumen Veröffentlichung des Stoffes wurde erstmals der Epilog hinzugefügt, dessen genaue Datierung ungeklärt ist. Gleichlautend auch in der »Kriegsfibel« zu finden, zählen diese Zeilen heute wohl zu den bekanntesten Zitaten Bertolt Brechts:
Für seine »Historienfarce« macht Brecht eine Engführung bestimmter Schlüsselereignisse der Karriere Adolf Hitlers mit der Aufstiegsgeschichte eines Gangsters, die eine gewisse Ähnlichkeit zu der Biografie Al Capones aufweist. Die deutschen Kapitaleigner der 1930-er Jahre (Junker und Industrielle) übersetzt er in Mitglieder eines von Absatzschwierigkeiten bedrängten Karfiol-Trusts in Chicago (Karfiol = Blumenkohl). Die wertegeleitete Stadtpolitik erweist sich als wenig wehrhaft gegen die halblegalen Machenschaften der Großunternehmer. Arturo Ui, ein kleiner Gangster, der sich zu Höherem berufen fühlt, wird zunächst noch aus den korrupten Geschäften herausgehalten, weiß aber die Schwächen der anderen geschickt gegeneinander auszuspielen. Scheinbar unaufhaltsam installiert er mit seiner Gangsterbande ein Regime des Terrors in der Stadt, gegen das aus Mitschuld und aus Angst niemand mehr aufzubegehren wagt. Die öffentliche Meinung wird frech manipuliert, die wenigen Stimmen der Wahrheit werden gewaltsam zum Schweigen gebracht.
Eine »Doppelverfremdung« erreicht Brecht in seinem Text durch die Entscheidung, seine Gangster und Händler in Jamben sprechen zu lassen, denn »die Verssprache macht das Heldentum der Figuren messbar«. Punktuelle Referenzen zu großen klassischen Stoffen von Shakespeare bis Goethe zeigen eine Möglichkeit, in ihrer idealistischen Übersteigerung Vorbild für den Faschismus zu sein. Der »hohe Stil« ist daher keine Parodie, sondern eine Entlarvung der moralischen Anstalt als höchst korrumpierbar.
Brechts Zeitgenossen konnten natürlich jeden Baustein und jede Figur der Parabel, die er auf »die Ebene von Staat, Industriellen, Junkern und Kleinbürgern« beschränkt, leicht auf ihr reales Pendant und Ereignis zurückführen. Schrifttafeln mit konkreten Hinweisen, welche die Aufführung unterbrechen sollten, hätten das weiter befördert. Trotzdem war es Brecht ein besonderes Anliegen, die eine Ebene nicht zugunsten der anderen zu betonen, sondern ein eigenständiges Narrativ zu entwickeln, das auch ohne zeitgeschichtliche Referenzen einer schlüssigen Dramaturgie folgt. Am 1. April 1941 schreibt er dazu in sein Arbeitsjournal:
»Im ui kam es darauf an, einerseits immerfort die historischen vorgänge durchscheinen zu lassen, andererseits die ‘verhüllung’ (die eine enthüllung ist) mit eigenleben auszustatten, dh, sie muß - theoretisch genommen - auch ohne ihre anzüglichkeit wirken. unter anderem wäre eine zu enge verknüpfung der beiden handlungen (gangster- und nazihandlung), also eine form, bei der die gangsterhandlung nur eine symbolisierung der andern handlung wäre, schon dadurch unerträglich, weil man dann unaufhörlich nach der ‘bedeutung’ dieses oder jenes zuges suchen würde, bei jeder figur nach dem urbild forschen würde, das war besonders schwer.«
Für ein deutsches Publikum stellt die Verlegung der Nazihandlung nach Chicago einen Verfremdungseffekt dar - für das Publikum in den USA vollzog sich damals damit wohl eher eine befremdliche Aneignung. Hitler diente in den USA als politischer Fetisch in Gestalt einer Verkörperung maximal unamerikanischen Ungeistes. Dass Brecht den Nazismus entnationalisierte und durch die Auswahl bzw. Reduktion der Kausalitäten, die zur Machtergreifung Hitlers führten, ursächlich auf die Logik des Kapitalismus konzentrierte, traf in den USA nicht den herrschenden Geschmack.
Obwohl 1941 geschrieben und von Brecht »als aufführung von 1941 gesehen", kam das Stück schließlich erst 1958, nach Bertolt Brechts Tod zwei Jahre zuvor, in Deutschland auf die Bühne, in den USA noch später. In der posthumen Veröffentlichung des Stoffes wurde erstmals der Epilog hinzugefügt, dessen genaue Datierung ungeklärt ist. Gleichlautend auch in der »Kriegsfibel« zu finden, zählen diese Zeilen heute wohl zu den bekanntesten Zitaten Bertolt Brechts:
Ihr aber lernet, wie man sieht statt stiert
Und handelt, statt zu reden noch und noch.
So was hätt einmal fast die Welt regiert!
Die Völker wurden seiner Herr, jedoch
Daß keiner uns zu früh da triumphiert -
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem
das kroch!
Und handelt, statt zu reden noch und noch.
So was hätt einmal fast die Welt regiert!
Die Völker wurden seiner Herr, jedoch
Daß keiner uns zu früh da triumphiert -
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem
das kroch!
Diese deutliche Warnung wendet sich direkt an ein Nachkriegspublikum, welches über ein Wissen und einen Erfahrungshorizont von Krieg und Vernichtung verfügt, der dem Stück qua seiner Entstehungszeit noch gar nicht eingeschrieben sein konnte. Allerdings traf Brecht eben auch zum Zeitpunkt der Entstehung des Stückes bereits bewusste Entscheidungen über die Auslassung von Ereignissen zwecks Wertung und Verdichtung der Parabel. Der eigentliche Gegenspieler der Nationalsozialisten, die organisierte Arbeiterschaft, fehlt in der Darstellung der Zusammenhänge. Auch das gemeine Volk als relevante Entität wird in der Gruppe der Gemüsehändler nur eindimensional abgebildet.
Vor allem ausgespart hat Brecht aber die menschenverachtende NS-Rassenideologie der Faschisten, aus der die Stigmatisierung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung und anderer unerwünschter Personengruppen resultierte, über die es 1941 keinen Zweifel geben konnte, wenn auch die systematische Vernichtung von Millionen von Menschen noch bevorstand.
Es ist Brecht vorgeworfen worden, dass die Satire als Gattung der Tragweite des nationalsozialistischen Verbrechens nicht angemessen sei, weil sie nicht den nötigen Ernst walten lasse. Angesichts der Uraufführung in Stuttgart 1958 fragt DIE WELT: »Was soll uns die Kostümierung des Grauens als Gaunerstück, da wir ein Stück Apokalypse erlebten?« Man kann nur vermuten, dass diese Rezension nicht von einer Person verfasst wurde, welche die Hölle eines NS-Vernichtungslagers überlebt hat, und mit dem »wir« im Text eher die deutsche Bevölkerung im Nachkriegsdeutschland gemeint ist, die sicherlich auch Schlimmes erlebt hat, aber eine »Apokalypse« doch eher für all jene Millionen, die sich nicht mehr äußern können, mitgestaltet und verantwortet hat.
Brecht ging es nicht darum, mit seiner Satire die Nazis zu veralbern, sondern den »gefahrvollen Respekt vor den großen Tötern zu zerstören«. Der Faschismus trat seinen Siegeszug unter der Mitwirkung Vieler an. Gerade die nur periphere Verhandlung der Stimme des Volkes im Ui verweist umso mehr auf die reale Theatersituation und die sich je nach Wissensstand radikal verändernde Rezeption des Stoffes macht eine Beschäftigung auch aus heutiger Perspektive relevant. Das Stück untersucht Bedingungen des Untergangs bürgerlicher Demokratie im Würgegriff von Kapitalkonzentration und Krise und im Aufstieg des »Starken Mannes«. Ui ist zwar ein Gangster, aber einer, der seinen Weg über den Staat geht und sein Verbrechen zur neuen Ordnung erhebt. Strategien der Aneignung von Diskursen, Umdeutung von Werten, Einschüchterung und Stigmatisierung, die postfaktische Erschaffung von scheinbar alternativlosen neuen Realitäten verweisen direkt auf unsere Gegenwart. Mit einem neuen Epilog von Soeren Voima spielt sich der Arturo Ui in Christian Weises Inszenierung hier in Frankfurt mühelos aus der Rezeptionsgeschichte in eine Zeitgenossenschaft mit uns hinein.
Vor allem ausgespart hat Brecht aber die menschenverachtende NS-Rassenideologie der Faschisten, aus der die Stigmatisierung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung und anderer unerwünschter Personengruppen resultierte, über die es 1941 keinen Zweifel geben konnte, wenn auch die systematische Vernichtung von Millionen von Menschen noch bevorstand.
Es ist Brecht vorgeworfen worden, dass die Satire als Gattung der Tragweite des nationalsozialistischen Verbrechens nicht angemessen sei, weil sie nicht den nötigen Ernst walten lasse. Angesichts der Uraufführung in Stuttgart 1958 fragt DIE WELT: »Was soll uns die Kostümierung des Grauens als Gaunerstück, da wir ein Stück Apokalypse erlebten?« Man kann nur vermuten, dass diese Rezension nicht von einer Person verfasst wurde, welche die Hölle eines NS-Vernichtungslagers überlebt hat, und mit dem »wir« im Text eher die deutsche Bevölkerung im Nachkriegsdeutschland gemeint ist, die sicherlich auch Schlimmes erlebt hat, aber eine »Apokalypse« doch eher für all jene Millionen, die sich nicht mehr äußern können, mitgestaltet und verantwortet hat.
Brecht ging es nicht darum, mit seiner Satire die Nazis zu veralbern, sondern den »gefahrvollen Respekt vor den großen Tötern zu zerstören«. Der Faschismus trat seinen Siegeszug unter der Mitwirkung Vieler an. Gerade die nur periphere Verhandlung der Stimme des Volkes im Ui verweist umso mehr auf die reale Theatersituation und die sich je nach Wissensstand radikal verändernde Rezeption des Stoffes macht eine Beschäftigung auch aus heutiger Perspektive relevant. Das Stück untersucht Bedingungen des Untergangs bürgerlicher Demokratie im Würgegriff von Kapitalkonzentration und Krise und im Aufstieg des »Starken Mannes«. Ui ist zwar ein Gangster, aber einer, der seinen Weg über den Staat geht und sein Verbrechen zur neuen Ordnung erhebt. Strategien der Aneignung von Diskursen, Umdeutung von Werten, Einschüchterung und Stigmatisierung, die postfaktische Erschaffung von scheinbar alternativlosen neuen Realitäten verweisen direkt auf unsere Gegenwart. Mit einem neuen Epilog von Soeren Voima spielt sich der Arturo Ui in Christian Weises Inszenierung hier in Frankfurt mühelos aus der Rezeptionsgeschichte in eine Zeitgenossenschaft mit uns hinein.
Diesen und andere begleitende Texte zur Inszenierung finden Sie im Programmheft, das zu den Vorstellungen und auch an der Vorverkaufskasse sowie im Webshop erhältlich ist.